Eröffnung am 24.09.2017 (vlnr.) Kerstin Möller, Simon Frsich, Alexander Steig, Fotos: © Lerchendorff
Eröffnungsrede von Simon Frisch
Eine schwarze Box, keine Namen, keine Bilder. Hier waren, in der Weißenseestr.7-15, Zwangsarbeiterinnen interniert aus dem Außenlager Agfa-Kommando des KZ Dachau. Wenn wir das hören, wollen wir reflexartig mehr wissen. Wer waren diese Frauen, wie sahen sie aus? Wo kamen sie genau her, wie haben sie gelebt, was haben sie erlebt? Wir wollen ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem wir ihre persönliche Geschichte erzählen. Aber diese temporäre Gedenkstätte „Kamera“ gibt den Opfern kein Gesicht, keinen Namen.
Vor drei Wochen wurde in München das Denkmal für den Terroranschlag der Olympiade 1972 eröffnet. Bei dem Denkmal steht die persönliche Geschichte der israelischen Olympioniken im Fokus, die bei dem Terroranschlag getötet wurden. Ihre Namen sind groß angeschrieben, ihre Fotos sind zu sehen. Die Stimmen der Presse begrüßen das Denkmal, endlich könne man die Menschen persönlich kennenlernen, die bei dem Attentat getötet wurden. So kennen wir das. Das ist es, was gelingen soll: Die Toten leben in der Erinnerung weiter unter uns.
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll… seit einiger Zeit fühle ich ein Unbehagen gegenüber solchem Umgang mit Opfern in der Erinnerungskultur. Das Projekt „Kamera“ hat mich dazu angeregt, dafür Worte zu suchen. Was für ein Bedürfnis ist das denn, den Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Wessen Bedürfnis, wem wird was gerecht?
Wir sind gewöhnt Vergangenheitsbewältigung mit Hinsehen zu verbinden: wir zeigen die Toten, zeigen die Opfer, wir nennen ihre Namen und sagen wer sie waren, wir erzählen von ihrem Sterben, ihren Leiden und von ihrem Leben. Wir lassen ihnen, so meinen wir, auf diese Weise Gerechtigkeit widerfahren.
Erst kürzlich stieß ich wieder einmal auf einen alten Cartoon von dem französischen Cartoonisten Sempé, auf dem eine große Wolke zu sehen ist, aus der eine Hand auf einen Mann auf der Straße herunterzeigt und in großen Lettern donnert eine Stimme aus dem Himmel „Du kommst nie ins Fernsehen“. Die Anonymität war der für den durchschnittlichen Menschen der Normalfall bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts. Andy Warhols Satz jeder werde für wenigstens 5 Minuten berühmt, aus dem Geist der Pop-Art klang lange wie eine Verheißung. In den Netzwerken und vernetzten Medien, in den sozialen Medien vor allem hat sich etwas verändert, und auch der Klang von Warhols Satz hat sich verändert.
Als um 2005 im Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung, eine sehr umfangreiche Biografie eines Jugendlichen erschien, die private und persönliche Details enthielt, empörte sich der Betroffen sehr über diese Veröffentlichung. Die Redaktion aber entgegnete, sie habe alle Angaben ohne Aufwand im Internet gefunden und nur für den Print zusammengestellt, er habe doch das alles selbst schon veröffentlicht. Diese Aktion hatte einen medienpädagogischen Hintergrund, aber für unsere Gedanken spielt die Geschichte eine andere Rolle: Mich interessierte besonders, dass der Junge sich empörte. Wir können das sofort nachempfinden, glaube ich, aber genau das lohnt sich, einmal genauer anzusehen: wir wollen offenbar gar nicht immer und so ohne weiteres, dass die Öffentlichkeit alles mögliche von uns erfährt. Wir wollen gar nicht alle ins Fernsehen. Ja, schon, das ist normal, aber Konsens war das nicht schon immer.
Sartre malt sich in seinem Drama „Geschlossene Gesellschaft“ (aus, dass die Menschen nach ihrem Tod in der „Hölle“, also in dem Zimmer, in dem sie eingesperrt sind, solange noch als Beobachter am Erdenleben teilnehmen können, so lange sich dort noch jemand an sie erinnere. Es ist erstaunlich, dass wir daran nie gezweifelt haben, dass es nach dem Leben ein Bedürfnis sei, dass die Lebenden an einen denken. Von Sartre her wird ein Paradigma erkennbar: Erinnerungskultur glaubt daran, dass man den Toten Genugtuung und Gerechtigkeit widerfahren lassen kann, indem man von ihnen persönlich so lange wie möglich erzählt, von ihnen liest usw. Aber es geht gar nicht so sehr, um das Leben nach dem Tode, es geht um Leben und Tod im Leben. Die öffentliche Bekanntheit ist eine bestimmte Konzeption von Lebendigkeit, und Unsterblichkeit gehört dazu. Es ist aber keine anthropologische Konstante: die Kultur des öffentlichen Ruhms, hat auch ihre Epoche und ihren kulturellen Ort: in der Antikenrezeption der Renaissance kommt der Gedanke in Europa wieder in Mode, sich durch wichtige Taten berühmt und unsterblich auf Erden zu werden. Tatsächlich spielt hier implizit ein Vorort des Todes eine Rolle, die Vorstellung, dass man solange die Welt existiert, irgendwie zu dem allen auch als Toter noch dazu gehört – und dass man entsprechend Anrecht auf, aber auch ein Bedürfnis nach, gerechter Behandlung hat.
Malen wir mal ein anderes Bild: stellen wir uns vor, wir sind gestorben und sind froh, dass wir mit dem ganzen Erdenleben nichts mehr zu tun haben. Wir haben neue Aufgaben, andere Dinge sind zu tun, wir sind auch andere Wesen und unser früheres Leben interessiert uns nicht mehr sehr. Stellen wir uns weiter vor, dass die Erinnerung auf der Erde durch die Lebenden uns immer wieder aufruft und stört.
Ich stelle mir weiter vor, dass ich getötet wurde in einem politischen Kampf, und deswegen erhalte ich ein Denkmal, Bücher werden über mich geschrieben. Unter den Lebenden darf jeder erfahren, wer ich war, was ich gemacht habe, wie ich gelebt und wie ich gelitten habe usw. Faszinierend, für viele ein Gefühl des Trosts, der Genugtuung…aber eigentlich möchte ich das nicht, und ich kann mir vorstellen, dass viele das eigentlich nicht möchten. Was Tote mögen oder nicht mögen, ob sie überhaupt etwas mögen können, das können wir natürlich nicht wissen. Aber es geht auch um etwas ganz anderes in dieser Frage: es stellt sich die Frage, ob uns auf die Herausforderung des Denkmals und der Erinnerung nur die Antwort der Veröffentlichung einfällt: die Nennung von Namen, das Zeigen von Bildern, das Erzählen von Geschichten. Was machen wir denn da eigentlich? Dürfen wir mit den Toten so umgehen - im Namen der Gerechtigkeit? Warum sind Menschen plötzlich so berührbar, so verfügbar, wenn sie tot sind, vor allem, wenn sie Opfer von politischer Gewalt geworden sind?
Aber jetzt wird es schwierig. Wenn wir jetzt sagen: Rühren wir sie nicht an, sie haben ein Recht auf Ruhe. Das klingt wie „die Vergangenheit soll ruhen.“ Wahrscheinlich ist da auch etwas richtig, es klingt nicht nur falsch: eine ruhende Vergangenheit. Aber oft hören und sagen wir den Satz gerade da, wo sie eben nicht zur Ruhe zu bringen ist. Viele Vergangenheit ruht ja wirklich. Und warum sollte sie nicht? Der Satz meint oft: die Vergangenheit soll Ruhe geben, wo sie es nicht tut, wo sie beunruhigt. Unsere Beunruhigung soll…soll aufhören. Die unruhige Vergangenheit lebt in uns noch, sie ist auch unsere Lebendigkeit, auch wenn wir sie nicht gut finden. Wie kann sie ruhen, wir müssten einen Teil von uns betäuben?
Bauen wir einen großen schwarzen Kasten und stecken sie da rein, und keiner sieht was. Nun kann man aber nicht gerade sagen, dass man diesen Kasten nicht sieht. Was machen wir eigentlich in der Erinnerungskultur? Worum geht es denn? So richtig verstehen wir das mit der Beunruhigung noch nicht.
Der Münsteraner Zoologe, Verhaltensbiologe und Theologe Rainer Hagencord, der sich viel mit Fragen der Ethik im Umgang mit den Tieren beschäftigt hat, erzählte vor ca. im Deutschlandfunk eine Geschichte. Als Priester machte er die Frage der Würde der Tiere immer wieder zum Thema. Eine Landwirtin kam zu ihm und sagte: „Wissen Sie, wenn ich mit dem Wort ‚meine Schweine haben eine Würde‘ in den Stall gehe, kann ich meine Arbeit nicht machen – aber ich muss sie machen.“
Das ist die Antwort, an der wir immer halt machen, wir kennen sie. Das Leben muss weitergehen, grausam, aber es ist eben die Wirklichkeit. Der katholische Theologe Hagencord fragt aber sofort weiter: Hagencord sagt: Da werde dann deutlich, dass eine Art der Tierhaltung, in der Tiere reduziert würden zu Rohstoffen auch an der Seele des Menschen nicht vorübergeht, dass es letztlich zu einer - das Wort sagt es - Verrohung führe. Der Umgang mit den Tieren frage die Seele an, das Animal zeige sich in der Anima.
Von hier eröffnet sich ein neuer Aspekt auf unsere Frage: wie berührt unser Umgang mit Toten, und nochmal solchen, die politischen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, unsere Seele? Und sind die Toten nicht auch manchmal Rohstoff? In Auseinandersetzungen und Streitereien um Schuld und Sühne, aber auch in politischen Machtkämpfen? Aber auch in der Kunst, aber auch von Werken der Erinnerung, von Denkmälern, von politischen Debatten.
Der öffentliche Kunstdiskurs spendet gegenwärtig Arbeiten eine besondere Aufmerksamkeit, die ihre Relevanz aus politischen und humanitären Notlagen oder aus Verbrechen zu beziehen versuchen. Die Kunst kann ein Ort sein, an dem offen darüber nachgedacht wird, wie man an die Toten erinnert. Die Frage der Ästhetik ist kein formales Problem, die künstlerische Lösung ist immer in eine Ethik verschlungen.
Die Frage der Würde, die Hagencord aufgeworfen hat, weist vielleicht einen Weg zurück zur Kamera. Wenn Tote eine Würde haben, dann wissen wir nicht, was ihnen angemessen ist. Dieser schwarze Kasten gibt uns Anhaltspunkte: er steht hier sichtbar und er hält sich zugleich dezent zurück, er reißt die Toten nicht aus ihrer Ruhe, aber er ruft uns herbei, oder steht uns im Wege. Indem er selbst schweigt und schwarz ist, verweigert er uns aber die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und geschwätzig zu werden. Um Ruhe zu finden und Würde und lebendige Kraft, müssen wir zuerst einmal - und zuerst einmal wir - ruhig werden, und hinschauen und auch annehmen, dass wir es nicht begreifen. Aber er ist nicht nur einfach schwarz und dunkel, er ist auch eine stilisierte, überdimensionierte Kamera. Eine Kamera macht Bilder, aber das ist auch wegen Agfa, und darin wächst dem Kasten eine unschuldige Dinghaftigkeit zu, die ihm seine eigentümliche Präsenz verleiht. Wir können es nicht begreifen.

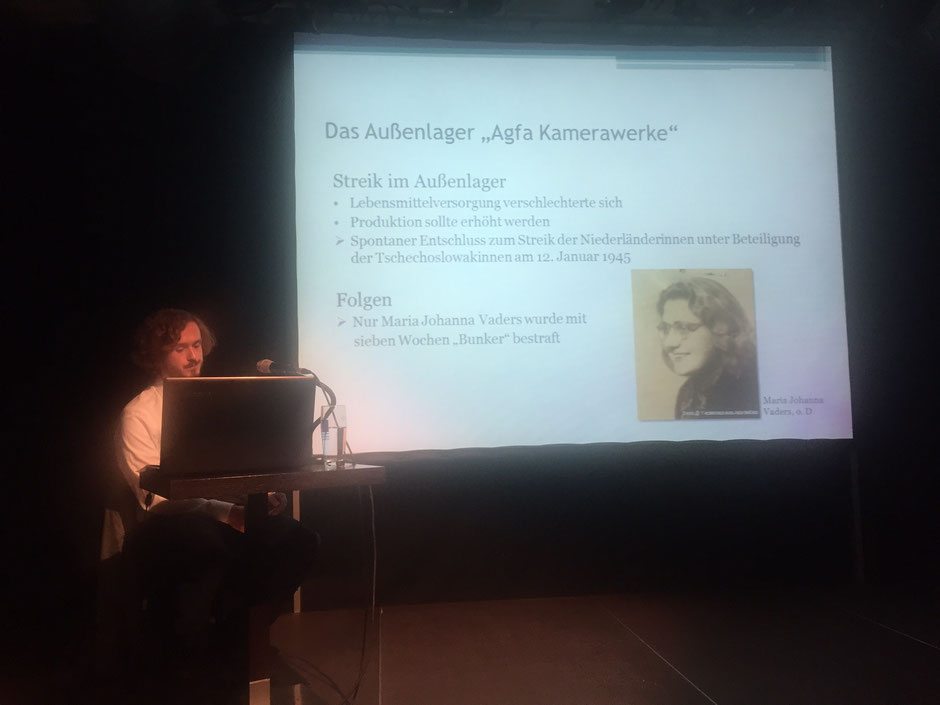
Podiumsdiskussion "Mahnmal - Zur Problematik künstlersicher Interventionen 'im Dienste' der Erinnerungsarbeit im Giesinger Bahnhof am 26.09.2017
vlnr. Alexander Steig, Ralf Homann, Heinz Schütz, Marc Gegenfurtner, Fotos: © Sepehri, 2017

Barbara Hutzelmann führt am 27.09.2017 im Giesinger Bahnhof in das Leben von Kiky Heinsius ein, Foto: © Steig, 2017
Lydia Starkulla liest ausgewählte Passagen aus dem Erinnerungsbericht von Kiky Gerritsen Heinsius im Giesinger Bahnhof am 27.09.2017 ,Foto: © Steig
Führung von und mit Karin Pohl vom ehemaligen Agfa-Gelände (Ella-Lingens-Platz) zum Außenlager Agfa-Kommando, Weißenseestraße 7 am 28.09.2017, Fotos: © Steig

Herr und Frau van Ommen und Alexander Steig, Foto: o. A., 2017















